Die Welt der Schwingungen
Umherschweifende Planeten

Am blauen Himmel nähert sich die Sonne dem Horizont … und geht unter – scheinbar, denn in Wirklichkeit dreht sich die Erde von ihr weg. Es wird dunkel, Sterne erscheinen, die Nacht für Nacht zu immer gleichen Bildern geordnet sind. Doch nach einigen Nächten erkennt man zwischen den Fixsternen einige, die ihre Position verändern: die Planeten. Wie die Erde, von der aus wir sie beobachten, umkreisen auch sie die Sonne.
„Das Wort Planet geht zurück auf griechisch πλανήτης planētēs ‚Wanderer‘ bzw. ‚umherschweifend‘ zu πλανάομαι planáomai, das auf Deutsch ‚umherirren, umherschweifen, abschweifen‘ bedeutet und sich im Altgriechischen auf eine Herde bezog, die sich über die Weide ausbreitet. Daher wurden Planeten früher auch eingedeutscht als Wandelsterne bezeichnet, im Sinne von ‚umherschweifende‘ bzw. ‚wandernde‘ Lichtgestalten am Himmel.“ (Wikipedia)
Alle Planeten bewegen sich nahezu in einer Ebene um die Sonne – vergleichbar mit den Rillen einer Schallplatte. Deshalb erscheinen sie nachts auf derselben Bahn, die auch die Sonne am Tag beschreibt. Durch die Erdrotation gehen sie im Osten auf, ziehen über den Süden und sinken im Westen wieder unter. Gegenüber den Fixsternen jedoch verschieben sie sich Nacht für Nacht ein Stück weiter nach Osten – entgegen ihrer täglichen Himmelsbahn. Ihre Umlaufperioden, Metren, Töne und Farben sind in der Tabelle auf Seite 18 aufgeführt.
Merkur
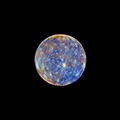
Venus

Mars
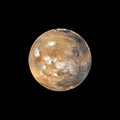
Jupiter

Saturn

Uranus
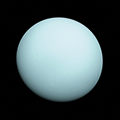
Neptun
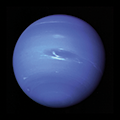
Pluto

Merkur
Von der Erde aus lassen sich mit bloßem Auge bis zu fünf dieser Himmelswanderer erkennen. Der Planet Merkur ist dabei nur selten sichtbar, da er der Sonne sehr nahe steht. Nur in der Nähe seines größten Winkelabstands von 28° zeigt er sich kurzzeitig: am Morgenhimmel knapp vor Sonnenaufgang im Osten oder am Abendhimmel kurz nach Sonnenuntergang im Westen.
Venus
Innerhalb der Erdbahn umläuft auch unser Nachbarplanet Venus die Sonne. Von der Erde aus gesehen entfernt sie sich nie weiter als 47° von ihr. Deshalb erscheint sie entweder im Osten als „Morgenstern“ oder im Westen als „Abendstern“ – jedoch nie um Mitternacht.
Eine Besonderheit ist die Figur, die ihre Bahn am Himmel innerhalb von acht Jahren zeichnet: Da sie die Sonne in 0,615 Jahren umrundet, also in einem Verhältnis, das nahezu dem Goldenen Schnitt zum Erdenjahr entspricht, entsteht dabei eine Form, die einer fünfblättrigen Blüte ähnelt. Mehr dazu unter Venustransite auf Seite 27.
Mars
Die Erde ist dritte Planet im Sonnensystem, der Mars folgt als vierter und äußerer Nachbar. Steht er im Tierkreis der Sonne gegenüber, geht er – wie der Vollmond – bei Sonnenuntergang im Osten auf und bleibt die ganze Nacht über sichtbar. Dasselbe gilt auch für die weiter außen kreisenden Planeten.
Jupiter
Jenseits der Marsbahn folgt Jupiter. Er ist der größte Planet des Sonnensystems und rund fünfmal weiter von der Sonne entfernt als die Erde. Am Nachthimmel strahlt er heller als alle anderen Wandelsterne.
Saturn
Der zweitgrößte Planet, Saturn, ist vor allem durch sein Ringsystem bekannt, das schon mit kleinen Fernrohren sichtbar wird. Er umkreist die Sonne in etwa 10 AE (Astronomische Einheit) Entfernung. Jahrtausendelang galt er als äußerster Wandelstern, bis ab dem 18. Jahrhundert weitere Planeten entdeckt wurden.
Uranus
1781 entdeckte Sir Friedrich Wilhelm Herschel mit einem selbstgebauten Teleskop den Planeten Uranus. Er ist etwa 20 AE von der Sonne entfernt, doppelt so weit als Saturn. Mit bloßem Auge lässt er sich nur unter außergewöhnlich guten Bedingungen erkennen, da er nur eine scheinbare Helligkeit der 6. Größe hat – alle anderen frei sichtbaren Planeten sind deutlich heller (mindestens 1. Größe).
Neptun
1846 schloss der Mathematiker Urbain Le Verrier aus Unregelmäßigkeiten in der Uranusbahn auf die Existenz eines weiteren Planeten. Kurz darauf bestätigte der Astronom Johann Gottfried Galle die Vorhersage und entdeckte Neptun – rund 30 AE von der Sonne entfernt.
Pluto
Erst 1930 wurde Pluto entdeckt. Er ist nur etwa ein Drittel so groß wie der Erdmond und bewegt sich auf einer stark exzentrischen Bahn in rund 40 AE Entfernung um die Sonne. Seit 2006 zählt er offiziell nicht mehr zu den Planeten, sondern wird als „Zwergplanet“ eingestuft.
Kleinplaneten
Seit der Entdeckung Plutos wurden immer mehr kleine Körper jenseits des Neptuns gefunden.
Deshalb definierte die Internationale Astronomische Union (IAU) 2006 den Begriff „Planet“ genauer: Ein Planet muss annähernd rund sein, die Sonne umkreisen und seine Umlaufbahn von anderen Objekten bereinigt haben. Ein Zwergplanet erfüllt dieselben Kriterien, außer dass er seine Bahn nicht vollständig räumt. Nach dieser Definition zählt Pluto zu den Zwergplaneten, während Neptun der äußerste Planet des Sonnensystems ist.
Zu den Kleinplaneten, auch Planetoiden genannt, zählen Asteroiden, Trojaner, Zentauren und Transneptunischen Objekte. Bis 2025 wurden knapp 1,5 Millionen Kleinplaneten bekannt. Stimmdaten von rund 100 dieser Objekte sind auf planetware.de abrufbar. Zudem durchqueren Kometen und Meteoriden das Sonnensystem. Die Stimmdaten von gut 100 solcher Kleinplaneten sind auf planetware.de in einem PDF gelistet.

Monde
Viele Planeten werden von einem oder mehreren Trabanten begleitet. Merkur und Venus haben keine Monde, die Erde einen, der Mars zwei, Jupiter 79 und Saturn 83. Einige sind so groß, dass sie bereits in kleinen Teleskopen sichtbar sind. Uranus besitzt 27, Neptun 14 und selbst der Zwergplanet Pluto hat 5 Monde.
 Von Fritz Dobretzberger lizensiert unter CC BY-NC-SA 4.0
Von Fritz Dobretzberger lizensiert unter CC BY-NC-SA 4.0
Nichtkommerzielle Weitergabe unter gleichen Bedingungen